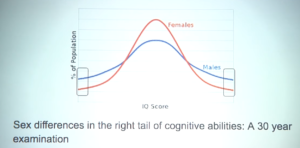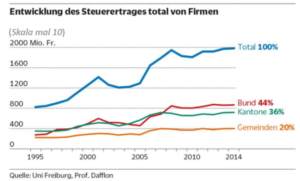Dieser Text erschien auf „Nebelspalter online“ vom 17. April 2024.
Unter dem Eindruck jüngerer politischer Ereignisse und Positionsbezüge in der Schweiz denkt man spontan an den berühmten Vierzeiler „Lichtung“ des österreichischen experimentellen Lyrikers Ernst Jandl: «manche meinen / lechts und rinks / kann man nicht velwechsern / werch ein illtum». Das aktuellste Muster bietet die Abstimmung vom 3. März über die 13. AHV-Rente. Sympathisanten der Polparteien links und rechts verhalfen der Volksinitiative der Gewerkschaften vereint zum Erfolg.
Auch in der heisser werdenden Phase der Europapolitik sehen wir die Linke und die Rechte vereint in der lautstarken Gegnerschaft zu einem institutionellen Abkommen mit der EU. Es gibt aber wichtige Unterschiede, was die Motive betrifft, und das könnte durchaus politische Folgen haben.
Die Rechte, am lautesten die SVP-Prominenz, warnt vor einer geradezu existenziellen Schädigung der Sonderfall-Institutionen, also der direkten Volksrechte, des Föderalismus und einer strikt traditionell interpretierten Neutralität. Es geht für sie dabei um die besonderen Formate und Prozesse der politischen Willensbildung, die nach Auffassung der Rechten die Identität der Schweiz ausmachen. Es herrscht auf dieser fundamentalistisch geprägten Seite grosse Sorge um die Standfestigkeit der Linken.
Verteidigung der Steckenpferde
Denn die Linke hat die Institutionen nur in zweiter Linie im Sinn, anders gesagt als Mittel zum Zweck, um ihre politischen Steckenpferde zu reiten. Im Vordergrund steht für sie das Inhaltliche, wo konkrete Forderungen vorliegen und rote Linien verkündet wurden:
- Lohnschutz bis hinunter in kleinste Details (Spesenregelungen, Voranmeldefristen),
- Ausbau der flankierenden Massnahmen,
- Schutz des Service Public,
- das heisst keine Strommarktliberalisierung,
- keine Zulassung ausländischer Bahnunternehmen im Schienenverkehr,
- keine Marktöffnungen oder Privatisierungen bei Post/Postfinance,
- Erhalt der Mehrheit des Bundes an der Swisscom,
- Schutz der diversen, vor allem kantonalen Subventionsregimes zugunsten des Service Public inklusive Energiesektor mit all den kommunalen und regionalen Versorgern.
Für die Linke spielen die Institutionen nur deshalb eine Rolle, weil die politische Praxis gezeigt hat, dass die direkten Volksrechte es den Gegnern von Liberalisierungen und Privatisierungen auf dem breiten Feld des von der Linken definierten Service Public ermöglicht haben, das Parlament bei solchen Projekten mithilfe des Stimmvolks auszubremsen. Die Referendums- und Initiativmacht der Linken steigt mit jedem Abstimmungserfolg. Dies wiederum erhöht die Wirkung von Referendumsdrohungen, was das Parlament präventiv diszipliniert.
Die Linke ist nicht fundamental gegen ein institutionelles Abkommen. Sie möchte aber den Arbeitsmarkt und den Service Public von der Unterstellung unter ein institutionelles Abkommen mindestens teilweise ausschliessen,.
Schlüsselrolle der Linken
Die Konstellation «lechts und rinks vereint» vermittelt für die eben begonnenen Verhandlungen mit der EU wenig Hoffnung auf ein beidseitig zufriedenstellendes Ergebnis. Das könnte sich ändern, wenn die schweizerische Verhandlungsdiplomatie in Bezug auf die linken Forderungen derart viele Zugeständnisse der EU herausholen könnte, dass die Linke aus dem Boot, in dem sie vorderhand mit der Rechten sitzt, aussteigen würde – ein ziemlich unrealistisches Szenario.
Denselben Effekt auf die Auflösung der Vereinigung «lechts und rinks» hätte es, wenn die schweizerische Linke ihre roten Linien so weit zurück nehmen würde, dass die EU mit den schweizerischen Konzessionen leben könnte. Eine solche Entwicklung erscheint wahrscheinlicher als grosszügige Konzessionen der EU-Seite.
Sollte die Linke aus dem Boot mit den rechten Gegnern eines institutionellen Abkommens aussteigen, hätten wir parteipolitisch eine Stärkung der schädlichen Konstellation «alle gegen die SVP», die schon die Referenden zur Energie- und Klimapolitik belastete. Sie verleitet nämlich in Referenden viele Leute dazu, gar nicht zur Sache selbst abzustimmen, sondern das wohlige Gefühl zu geniessen, der ungeliebten SVP eins auswischen zu können. Und ein Referendum gegen ein vom Parlament verabschiedetes Abkommen mit der EU wäre unvermeidlich.