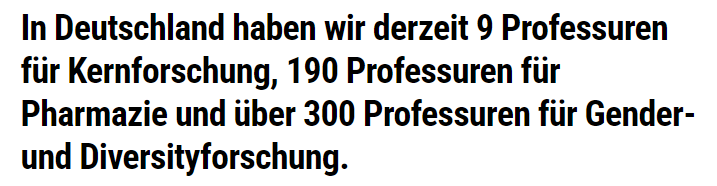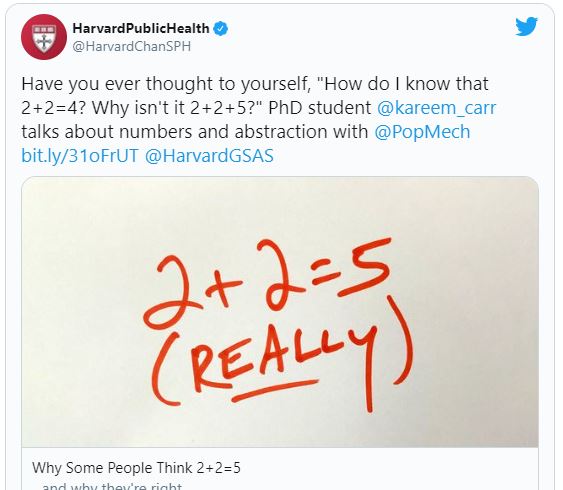«Wer eine ganz fortschrittliche Lösung will, verlangt Wahlrechtsalter 0…“, schrieb der bekannte Politikforscher Claude Longchamp in einem Beitrag vom 13. September 2019 auf swissinfo.ch. Aufgrund der Bezeichnung als „ganz fortschrittliche Lösung“ ist anzunehmen, dass Longchamp diese Wertung teilt. Wahlrechtsalter 0 würde das „Ideal“ der Maximalpartizipation verwirklichen. Mit der Diskussion um Stimmrechtsalter 16 kündigt sich ein weiterer Schritt zu der „ganz fortschrittlichen Lösung“ an. Die letzte grosse Veränderung fand 1991 mit der Herabsetzung des Wahlrechtsalters von 20 auf 18 Jahre statt. Der politische Prozess hatte 1970 mit den ersten parlamentarischen Beratungen begonnen, die Frage war allerdings schon mit der 68er-Bewegung aufgetaucht (Quelle: ch.ch).
Auch aktuell war es wieder eine Jugendbewegung, die das Thema „Stimmrechtsalter 16“ auf die politische Agenda beförderte. Mit den Klimastreiks der Schuljugend erhielt das Projekt neuen Schub. Das ist erstaunlich. Eher hätte diese Erfahrung bei informierten Erwachsenen Skepsis auslösen müssen. Stattdessen liess sich unsere Elite von Schulkindern die Leviten lesen. Kantons- und Gemeindeparlamente riefen auf Druck der Jugendlichen den „Klimanotstand“ aus. Auch in Kreisen von Wirtschaft, Medien, Wissenschaft und Kultur erfolgte eine opportunistische Solidarisierung mit den rabiaten Forderungen der Klimajugend. Warum die Hysterisierung der Klimadebatte (Greta Thunberg: „I want you to panic!“) ein Fortschritt sein soll – diese Frage müsste gerade in der hochpartizipativen Schweizer Demokratie zum Thema gemacht werden.
Ein Land im Partizipationsfieber
Gewisse Folgen der Einführung von Stimmrechtsalter 16 sind voraussehbar. Erstens würde die prozentuale Stimmbeteiligung weiter sinken. Zweitens ist ein leichter Rutsch nach links-grün zu erwarten – leicht dank der geringen absoluten Zahl und der niedrigen Stimmbeteiligung der jüngsten Stimmberechtigten. Beides wäre für die Schweiz tragbar. Es gibt aber trotzdem gute Gründe gegen die Absenkung des Stimmrechtsalters.
Wer Stimmrechtsalter 16 befürwortet, begründet dies gerne demografisch. Wegen der Überalterung brauche es einen Ausgleich zwischen Jung-Alt. Die 16- und 17-Jährigen hätten zudem noch die längste Zukunft und sollten deshalb über diese mitbestimmen können. Auch würde mit der Beteiligung an Wahlen und Abstimmungen das Interesse der jungen Menschen an politischen Fragen steigen; sie würden sich mehr informieren und engagieren. Diese gängigen Pro-Argumente klingen auf den ersten Blick plausibel. Doch beruhen sie auf irrigen Annahmen und auf einer zeitgeistigen Sicht demokratischer Politik. Dazu gehört auch der Glaube, höhere politische Partizipation bedeute automatisch eine bessere Demokratie.
Das Überalterungsargument gründet auf der falschen Meinung, dass die älteren Generationen bei Abstimmungen und Wahlen einen kürzeren Interessenhorizont hätten und deshalb kurzsichtig-egoistisch wählen würden. Doch viele Ältere haben eigene Kinder und Enkel. Zudem stimmt das Bild des materiell egoistischen Stimmbürgers nicht, unter anderem, weil auch die Älteren den Versuchungen des „expressive voting“ unterliegen. Das bedeutet, dass das Entscheidungsverhalten stark vom emotionalen Gewinn bestimmt ist, den jemand aus der Beteiligung an Abstimmungen und Wahlen zieht. Die grüne Welle bei den Wahlen im letzten Herbst illustriert dies. Grün zu wählen vermittelte das gute Gefühl, auf der richtigen Seite des politischen Trends zu stehen.
Zum längeren Lebenshorizont der Jungen: Nicht nur die Zukunft spielt in dieser Sache eine Rolle, sondern auch die Vergangenheit. Junge haben noch kaum eine solche. Mangels eines entwickelten Geschichtsbewusstseins fehlt ihnen der Sinn für Verhältnismässigkeit, wie die rabiat-utopischen Forderungen an die Klimapolitik zeigen. Damit zusammenhängend: Junge Menschen haben noch nichts zu verlieren, ihr Idealismus ist gleichsam gratis. In ihren politischen Ansichten gewinnen dadurch moralgetränkte Faktoren ein massives Übergewicht.
Stimmrecht für die Handysüchtigsten?
Schliesslich kann auch das Argument, das Stimmrecht würde das politische Interesse der Jungen wecken, und sie würden sich dann auch besser informieren, nicht wirklich überzeugen. Warum sollte man ausgerechnet die handysüchtigste Altersgruppe in den Kreis der politisch Mündigen aufnehmen? Die schädlichen Wirkungen dieser Sucht sind mittlerweile wissenschaftlich untersucht und belegt: dauernde Ablenkung, gestörte Konzentrationsfähigkeit, Sprachverwahrlosung, Unfähigkeit zur Überwindung von Unlust, Gier nach Spass und Unterhaltung, sinkende kulturelle Bildung und Überschätzung der eignen Urteilsfähigkeit. Pointiert drückte sich der bekannte englische Publizist Douglas Murray in einem Interview, aus: Unwissende Menschen seien anmassend, so dass sie sich selbst zum Richter, zu Geschworenen und Henkern der Vergangenheit ernennen, ohne etwas von Geschichte zu verstehen.
Wir sollten uns wieder an eines der wichtigsten Projekte der jungen Schweizer Demokratie im 19. Jahrhundert erinnern. Die Einrichtung der kostenlosen staatlichen Volksschule beruhte auf der Überzeugung, dass Bildung die Voraussetzung für die politische Beteiligung ist. Wir wollen keine Mob-Demokratie, in der die Strasse und behördlich geduldete und gerichtlich verschonte rechtsbrechende Extremisten den Ton angeben. Wir wollen auch keine Hobby-Demokratie, in der es genügt, seine spontanen politischen Regungen ohne jeden persönlichen Aufwand ins „System“ einspeisen zu können – sei es via e-collecting, e-voting oder anderen Segnungen des Internets, die noch zu erwarten sind.
Dieser Text erschien, leicht gekürzt, als Gastkommentar im Gefäss „Meinung & Debatte“ der NZZ vom 6. Oktober 2020.