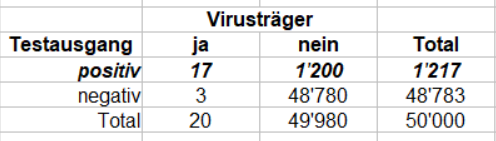Von Walter Rüegg und Hans Rentsch*
Vor fast genau zehn Jahren, am 11. März 2011, ereignete sich nach einem selbst für Japan gewaltigen Erdbeben mit nachfolgendem Tsunami der Reaktorunfall von Fukushima. In Europa löste die Reaktor-Explosion einen wahren Medien-Tsunami aus. In der Schweiz wurde aber nicht einfach über die Ereignisse in Japan berichtet, sondern diese wurden vielfach zum Anlass genommen, um die Risiken der eigenen AKW und die Wünschbarkeit eines „Atom-Ausstiegs“ in den Vordergrund zu rücken.
Im Mai 2011, also kaum zwei Monate nach dem Reaktorunfall, beschloss der schweizerische Bundesrat, schrittweise aus der Kernenergie auszusteigen. Die Bevölkerung stand noch voll unter dem Eindruck der Bilder der Reaktor-Explosion. Auch waren die Leute durch die ausstiegsgeneigten Berichte in den hiesigen Medien konditioniert. Der Zeitpunkt für eine Abkehr von der Kernenergie war somit günstig, hatte man doch mit Sicherheit eine Mehrheit der Bevölkerung hinter sich. Für die CVP, die im Abwärtstrend befindliche Partei der zuständigen Bundesrätin und Energieministerin Doris Leuthard, spielten wohl auch noch die im Herbst anstehenden Wahlen ins Kalkül hinein.
Die eidgenössischen Räte sanktionierten später den Ausstiegsentscheid des Bundesrats. Im Referendum vom Mai 2017 stimmte auch das Stimmvolk dem neuen Energiegesetz zu. Dort steht im Anhang der Passus „Rahmenbewilligungen für die Erstellung von Kernkraftwerken dürfen nicht erteilt werden.“, also ein Verbot zum Bau neuer AKW. Gemäss VOTO-Analyse war der endgültige Ausstieg aus der Kernenergie das wichtigste Abstimmungsmotiv der Befürworter des Energiegesetzes.
Eine alternative Politik: Aus dem „worst case“ lernen
Statt überstürzt die „Energiewende“ mit dem Ausstieg aus der Kernenergie auszurufen, hätte man aus „Fukushima“ erst einmal viel lernen können. Der Fall steht für einen „worst case“ wie er sich kaum irgendwo auf der Welt wiederholen könnte. Auslöser war ein Erdbeben der Stärke 9 bis 9,1 auf der Momenten-Magnituden-Skala (Mw). Diese heute gebräuchliche Skala ist logarithmisch, was bedeutet, dass die Stärke des Bebens exponentiell mit dem Skalenwert steigt. Dieses Tōhoku-Erdbeben gilt gemäss Wikipedia als das stärkstes Beben in Japan seit Beginn der Erdbebenaufzeichnungen. Schon vor dem Tsunami blieb praktisch kein Gebäude im betroffenen Gebiet stehen. Dazu kommt, dass das von einer 14 Meter hohen Tsunamiwelle beschädigte AKW eine der ältesten und nicht nachgerüsteten Anlagen aus den 1960er-Jahren ist. Diese war auch noch weniger gut gegen Tsunamis geschützt als ein zweites, etwas neueres AKW in wenigen Kilometern Entfernung, das unbeschädigt blieb.
Es braucht schon viel Phantasie, um aus diesen spezifischen Ausgangsbedingungen eines japanischen „worst case“ Folgerungen für vergleichbare Risiken in schweizerischen AKW abzuleiten. Noch aufschlussreicher für eine überlegte und sachlich abwägende Energiepolitik wäre es aber gewesen, man hätte vor politischem Aktivismus die Folgen der Reaktor-Explosion (Strahlenopfer) und der Massnahmen (Evakuation) analysiert.
Wie gefährlich sind radioaktive Strahlen?
Die biologische Wirkung eines Giftstoffes hängt von der Dosis ab. Bei radioaktiven Strahlen wird diese in Sievert (Sv) gemessen. 5 Sv auf einen Schlag sind meistens tödlich, doch was bewirken kleinere Dosen? Die gründlichen Untersuchungen der Überlebenden von Hiroshima und Nagasaki sind unsere beste Wissensquelle: Ab etwa 0.1 Sv scheinen die ersten Langzeiteffekte aufzutreten (1 Prozent Erhöhung der Krebstodesrate im Alter). Ab rund 1 Sv leidet man unter der Strahlenkrankheit, mit Symptomen ähnlich wie bei einer starken Chemotherapie.
Wird die gleiche Dosis über eine längere Zeitspanne verteilt, sind die Effekte wesentlich kleiner, um wie viel, ist umstritten. Auf jeden Fall erfreuen sich die Bewohner des beliebten Kurortes Ramsar im Iran einer völlig normalen Gesundheit, obwohl sie einer Lebensdosis von teilweise weit über 5 Sv (der tödlichen Schockdosis) ausgesetzt sind. Der Boden von Ramsar ist reich an Natururan und Radium und bestrahlt die Bewohner ein Leben lang. Auch in der Schweiz hat es – besonders im Granit der Alpen – überdurchschnittlich viel Uran im Boden. Entsprechend ist die Lebensdosis wesentlich höher als in Gegenden mit wenig Uran. Sie beträgt gemäss BAG 0.35 Sv, im Mittelland meist um 0.3 Sv, in den Alpen oft über 0.4 Sv, mit Spitzen von gegen 1 Sv.
Verursacht diese Strahlung mehr Krebsfälle? Dies zu bestimmen ist praktisch unmöglich. Solche Dosen haben nur einen schwachen oder gar keinen Einfluss auf die Krebsrate. Die Krebsentwicklung wird von zahlreichen Faktoren beeinflusst: Lebensstil, Nahrung, Umwelt, Bewegung und Gene. Jeder vierte stirbt deshalb an Krebs. Und selbst in der kleinen Schweiz variiert die Krebsrate zwischen den verschiedenen Regionen um typisch 10-30 Prozent; bei den einzelnen Krebstypen sind die Unterschiede noch viel grösser. Entsprechend widersprüchlich sind die unzähligen Studien, welche versuchen, die Wirkung von kleinen bis mittleren, zeitlich verteilten Strahlendosen zu bestimmen. Was klar ist: Solche Dosen sind, wenn überhaupt, nur schwach krebsfördernd.
In Anwendung eines extrem strengen Vorsorgeprinzips vertreten die Strahlenschutzbehörden die Hypothese, dass auch die kleinste Dosis schädlich sein kann. Dies erleichtert die Regulierung, ist aber auch ein Blankoscheck für beliebig tiefe Grenzwerte und ausufernde Bürokratie. Und die Hypothese mutiert schnell zur Meinung, dass auch die kleinste Dosis tödlich ist. So kommt es, dass die gesetzliche Limite auf 0.001 Sv pro Jahr gesunken ist, oder bei 80 Jahren Lebensdauer auf 0.08 Sv Lebensdosis. Die natürliche Strahlung, die genau gleich wirkt wie die vom Menschen verursachte, ist heute strenggenommen illegal.
„Strahlenphobie“ und das Evakuationsdilemma der Behörden
Die WHO hat nach den Ereignissen in Tschernobyl eine Lebensdosis von 0.35 Sv als Evakuationslimite empfohlen. Pikanterweise ist dies gerade die durchschnittliche Lebensdosis eines Bewohners der Schweiz, verursacht durch die natürliche radioaktive Strahlung. Die Internationale Strahlenschutzkommission (ICRP) empfiehlt heute eine Evakuation ab einer Lebensdosis zwischen 0.04 Sv und 0.06 Sv (berechnet aus der Forderung von weniger als 0.02 Sv im ersten Katastrophenjahr). Solche Dosen sind nur ein Bruchteil der natürlichen Dosis. Viele Fachleute halten Evakuationen bei solchen Dosiswerten für völlig unsinnig: Prof. Zbigniew Jaworowski, ehemaliger Präsident der UNSCEAR, sagte zu den Evakuationen von Tschernobyl: “The most nonsensical action, however, was the evacuation of 336’000 people.“
In Japan hat Prof. Shunichi Yamashita, einer der führenden Experten, eine Dosis von 0.1 Sv für unbedenklich erklärt. Die Folge war ein Shitstorm mit Beschimpfungen als Professor Mengele. Spiegel online berichtete damals unter dem Titel „Es herrscht Strahlenphobie“: „Der Mediziner Yamashita soll den Menschen im Katastrophengebiet die Wahrheit über die Strahlenrisiken erklären – und löst damit neue Ängste aus…. Yamashita hat viel zum Wissen über die Wirkung radioaktiver Strahlung beigetragen. Er wirkte an Studien über die Überlebenden des Atombombenabwurfs auf Nagasaki mit. Und als Abgesandter Japans hat er die Folgen des Reaktorunglücks von Tschernobyl untersucht; rund hundertmal war er dort. Jetzt soll er die Folgen der japanischen Reaktorkatastrophe erforschen – muss aber erleben, dass ihm in der Bevölkerung heftiger Widerstand begegnet.“
Dieser Vorfall illustriert das Evakuationsdilemma der Behörden. Um die Bevölkerung zu beruhigen, orientiert man sich an den sachlich nicht begründbaren Gefahrenempfindungen der Leute, was in Bezug auf die Evakuation zu einer weit überschiessenden Reaktion mit schädlichen Folgen führt. Versuche sachgerechter Aufklärung sind nicht nur unwirksam, sondern oft kontraproduktiv. Sie erhöhen die Ängste und den Widerstand in der Bevölkerung – ein Phänomen, das auch der prominente US-amerikanische Rechtswissenschaftler Cass R. Sunstein in seinem Buch „Gesetze der Angst“ überzeugend beschrieben hat.
Müssen wir die Alpen evakuieren?
Die am stärksten vom radioaktiven Fallout betroffene Zone von Fukushima umfasst etwa 100 km2. Ohne Evakuation mussten die Bewohner mit einer durchschnittlichen Lebensdosis von rund 0.4 Sv rechnen, mit Spitzen bis gegen 1 Sv. In der restlichen Evakuationszone (gut 1000 km2, heute noch 371 km2) wurde bereits bei viel kleineren Lebensdosen evakuiert. In weiten Teilen der Alpen sind die Lebensdosen höher. Konsequenterweise müsste man diese Gegenden evakuieren und absperren. Und zwar für ewige Zeiten, denn die natürliche Strahlung nimmt nicht ab. Zumindest nicht in menschlichen Zeiträumen, Uran hat eine Halbwertszeit von über 4 Milliarden Jahren.
Die gleichen Überlegungen gelten für viele andere Gebiete mit erhöhter natürlicher Strahlung. Diese findet man im Schwarzwald, im Erzgebirge, im Piemont, aber auch in Städten wie Rom oder Hongkong. Ganz zu schweigen vom bereits erwähnten Kurort Ramsar oder der Stadt Guarapari/Brasilien mit dem Beinahmen «die gesunde Stadt». Überhaupt fällt auf, dass die meisten Kurorte eine deutlich erhöhte Strahlung aufweisen. Könnte gar am Ende eine sanfte Bestrahlung der Gesundheit förderlich sein?
Interessant ist schliesslich dieser Vergleich: Fliehen die Bewohner der Fukushima-Evakuationszone – ein Gebiet mit relativ guter Luftqualität – nach Tokio oder in eine andere Grossstadt, kommen sie vom Regen in die Traufe. Die Luftverschmutzung in solchen Städten ist gesundheitlich wesentlich schlimmer als die Strahlung. Auf diesen Umstand wurde – im Zusammenhang mit Tschernobyl – bereits 2007 in einer wissenschaftlich fundierten Arbeit (peer-reviewed) von einem der führenden Umweltwissenschaftler hingewiesen. In der Schweiz müssten mehrere Dutzend Fukushima-Katastrophen gleichzeitig geschehen, um vergleichbare gesundheitliche Schäden zu verursachen wie durch die aktuelle Luftverschmutzung.
Ausstieg aus dem Ausstieg?
Kritik an der „Energiewende“ mit dem Verbot neuer AKW wird auch hierzulande allmählich salonfähig, weil die Einsicht wächst, dass
- ein massiver Ausbau der Solarenergie mit der Abschaltung der AKW das Problem der Winterstromlücke gemäss einer EMPA-Studie massiv verschärfen würde;
- Speicherlösungen technisch und wirtschaftlich in weiter Ferne liegen;
- auf Stromimporte im Winter angesichts der grossen Unsicherheit betreffend Integration in den europäischen Strommarkt (Stichwort „market coupling“) kein Verlass ist;
- die Versorgungssicherheit also nicht gewährleistet werden kann.
Da das Verbot neuer AKW im Gesetz und nicht in der Verfassung steht, kann das Parlament, wenn einmal bessere Einsicht einkehren sollte, im Prinzip das Gesetz jederzeit ändern. Ein Referendum wäre dann allerdings sicher, es sei denn, die Anti-AKW-Fundamentalisten würden über ihren eigenen Schatten springen – ganz nach dem Vorbild der finnischen Grünen, die sich jüngst zugunsten der Kernenergie ausgesprochen haben. Dafür stehen die Aussichten in unserem politischen System allerdings schlecht. Denn solange man mit einer Anti-AKW-Politik mehr als die Hälfte der Bevölkerung hinter sich weiss, gibt es in der Referendumsdemokratie keinen Anreiz für einen Richtungswechsel.
* Autoren:
Walter Rüegg, Dr.sc.nat. ETH, früherer Chef Strahlenschutz der Armee
Hans Rentsch, Dr.rer.pol.