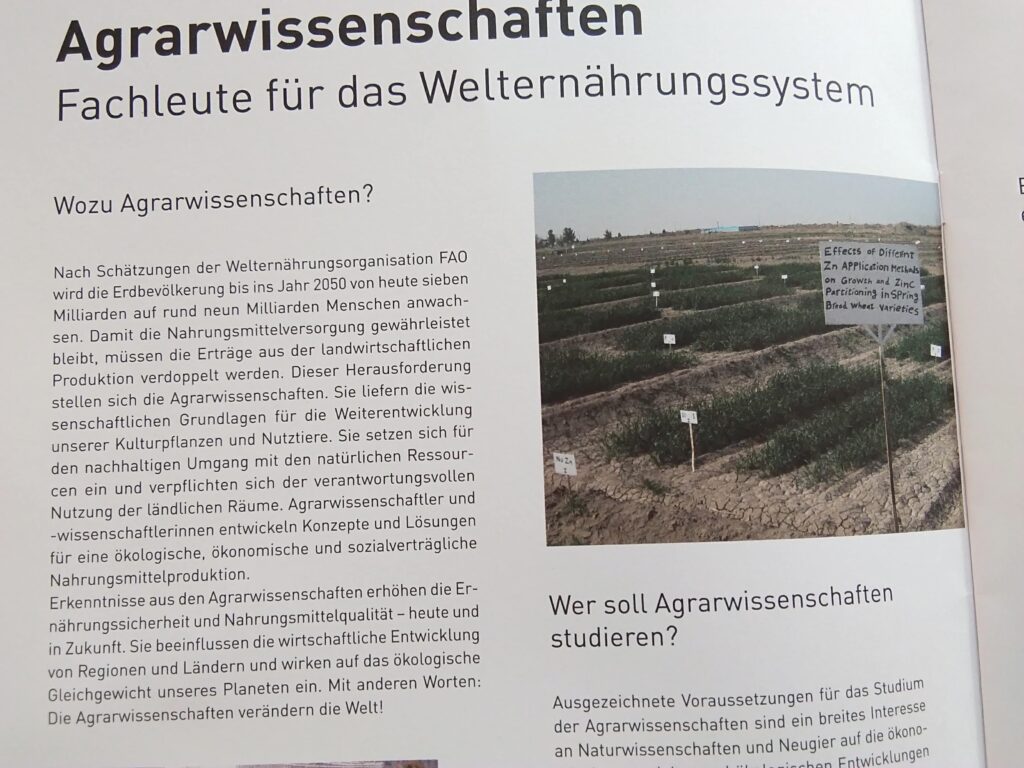Zu den aktuellen „Corona-Umfragen“
Eine Umfrage des Berner Instituts GfS für einen grossen Schweizer Verlag mit mehreren Massenmedien ergab die folgenden wenig überraschenden Ergebnisse (Quelle NZZ online):
- 94 Prozent der Befragten wollen mehr Eigenversorgung mit medizinischen Produkten.
- 90 Prozent sind der Meinung, dass die Schweiz „die Nahrungsmittelversorgung autonom garantieren muss“ (zitiert nach NZZ online).
- Fast 80 Prozent wollen die Globalisierung bremsen.
Was sind solche Umfragen wert, die von einem durchschnittlichen Wissensstand ausgehen, der näherungsweise wohl am besten mit Ignoranz bezeichnet werden könnte? Das ist keine elitär herablassende Kritik, sondern eine empirisch leicht überprüfbare Feststellung. Da man nicht alles wissen kann, hat jeder Mensch weite Felder des Nichtwissens. Auf gewissen Gebieten nichtwissend zu sein, ist die freie Wahl jedes Einzelnen.
Das Problem der Ignoranz hat aber in der Politik besondere Bedeutung. In der Demokratie, besonders in unserer halbdirekten, exisistiert eine Art moralische Partizipationspflicht. Und hier zählt jede Stimme gleich viel, unabhängig von der Wissens- und Urteilskompetenz. Genau so ist es auch in Umfragen. Nur wenige geben zu, zu einer gestellten Frage nichts oder zu wenig zu wissen, um eine Antwort geben zu können. Oft ersetzen Blitzurteile, die auf gerade leicht verfügbaren Eindrücken beruhen, oder gespeicherte, sofort abrufbare Vorurteile das fehlende Wissen.
Am vernünftigsten erscheint mir noch die Forderung nach mehr Eigenversorgung mit medizinischen Produkten, obwohl der Begriff „medizinische Produkte“ natürlich viel zu pauschal ist, um daraus etwas Präzises abzuleiten. Die sinnvollste Auslegung wäre wohl, „medizinische Produkte“ auf die Pandemie-Vorsorge einzuengen. Damit gelangen wir aber wohl oder übel zur grössten Unterlassung in der Vorsorgepolitik der Vergangenheit. Obwohl mehrere eigene und fremde Risikostudien die Pandemiegefahr klar und deutlich als das grösste Risiko für unsere Gesellschaft ermittelt hatten, waren wir in der Schweiz – trotz Pandemieplan „auf Papier“ – auf die Corona-Attacke schlecht vorbereitet. Dies, obwohl die Art der Vorsorge gut planbar war und auch genügend Zeit zur Verfügung gestanden hätte.
Begrifflich ebenfalls diffus ist die „Globalisierung“, die eine grosse Mehrheit der Befragten bremsen will. Was verstanden die Befragten unter „Globalisierung“? Und wie sollte das Bremsen denn vor sich gehen? Es sind ja nicht Staaten, die eine global vernetzte Wirtschaft aufgebaut haben, sondern Unternehmen mit neuen Geschäftsmodellen, permanenter Innovation und fortschrittlicher Technologie. Die Staaten und internationale Organisationen haben dazu gewisse Rahmenbedingungen geschaffen, die den freien Austausch von Gütern und Dienstleistungen zum Wohle aller ermöglichen sollten. Genau dies ist auch geschehen, und es hat diversen einst armen Ländern ermöglicht, ihren Wohlstand beträchtlich zu steigern und x Millionen Menschen aus der grössten Armut zu befreien. Selbstverständlich lässt sich die Globalisierung nur mittels staatlicher protektionistischer Eingriffe bremsen, und eine solche Politik ist nicht ohne Kosten zu haben, die direkt die Kaufkraft der Bevölkerung schmälern. Vielleicht sollte man den Leuten auch mal erklären, warum wir seit x Jahren keine Teuerung haben, obwohl die Preise der eher wettbewerbsschwachen Branchen der Binnenwirtschaft (inklusive staatliche und administrierte Preise) dauernd steigen!
Dem Mehrheitswunsch, die Schweiz möge für die Nahrungsmittelversorgung möglichst autonom werden, kann leider nicht entsprochen werden, denn es handelt sich schlicht um eine der hartnäckigsten Illusionen, die in der Bevölkerung kursieren. Ich hatte es bereits in einem früheren Blog-Eintrag so erklärt:
Da die Schweiz, in Kalorien ausgedrückt, rund 45 Prozent der Nahrungsmittel einführen muss, weil die beschränkte landwirtschaftliche Nutzfläche der Schweiz für eine wachsende Bevölkerung trotz intensivster Bewirtschaftung gar nicht mehr hergibt, ist jeder Gedanke an mehr agrarische Autonomie ein Hirngespinst. Entscheidend für die sichere Versorgung der schweizerischen Bevölkerung mit Nahrungsmitteln im Krisenfall sind eine nach Herkunft diversifizierte Beschaffung sowie eine hohe Zahlungsfähigkeit, die nur eine erfolgreiche Integration in die internationalen Waren- und Dienstleistungsmärkte garantieren kann. Aus dieser Risikoperspektive müssen auch Projekte von Freihandelsabkommen mit typischen Agrarexportländern (Mercosur, USA) beurteilt werden.
Womit wir wieder bei der Globalisierung wären. Nun ja, alles hängt halt ein wenig zusammen in unserer vernetzten Welt!
Mein Fazit:
1. Solange man den Leuten in Umfragen solche Fragen stellt, ohne auch auf wahrscheinliche nachteilige Folgen gewisser Politiken aufmerksam zu machen, sind die Umfrageergebnisse nicht viel wert. Denn politische Massnahmen zur Minderung eines bestimmten Risikos erhöhen in der Regel andere Risiken.
2. In einer deliberativen Demokratie hat die politische Elite eine Pflicht, gegen Fehlmeinungen in der Bevölkerung aufklärende Informationen zu liefern. Mustergültig tat dies Christian Hofer, der Direktor des Bundesamts für Landwirtschaft (BLW), jüngst in einem Interview mit der NZZ, als er sagte: „Wenn die Landwirtschaft so intensiv weiterproduziert, ist die Versorgungssicherheit gefährdet.“ Schön, dass diese Botschaft aus den Avenir Suisse-Publikationen „Der befreite Bauer“ und „Agrarpolitische Mythen“ endlich im BLW angekommen ist. Im Parlament stösst diese Botschaft weiterhin auf taube Ohren.
3. Das demokratische Prinzip „eine Person – eine Stimme“ sollte uns nicht blind machen für die Tatsache, dass es in Bezug auf Sachprobleme richtige und falsche Meinungen bzw. nützliche und schädliche Politiken gibt.