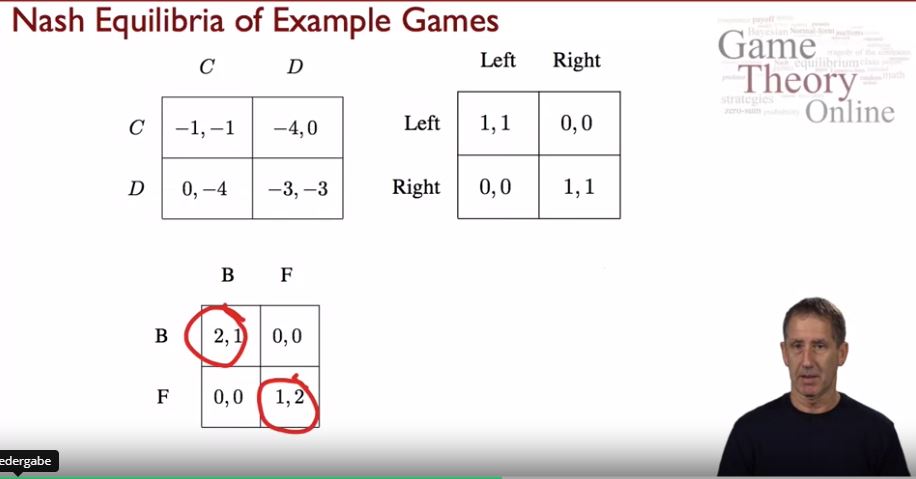Spekulationen über Corona-Effekte für Flugreisen
In einer der Sonntagszeitungen spekulierte ein Journalist über die wahrscheinlichen Folgen der COVID19-Krise auf die Fliegerei. So einfach wie halt in den Medien immer wieder mal über ökonomische Phänomene geschrieben wird, meinte der Autor des Beitrags, wenn die Flugzeuge künftig viel weniger dicht mit Sitzreihen belegt werden könnten, dann hätten vielleicht nur noch halb so viele Personen Platz. Das würde heissen, dass sich die Flugtarife wohl ungefähr verdoppeln müssten. Weitere Überlegungen über die möglichen Anpassungsprozesse aller Art fehlten.
Die erste logische Frage, die sich sofort stellt, betrifft die Reaktion der Nachfrage auf den Versuch von Fluggesellschaften, ihre Preise massiv zu verteuern. Der Effekt auf die Nachfrage nach Geschäftsflügen wäre wohl dank tieferer Preiselastizität weniger ausgeprägt als bei Ferienreisenden. Selbstverständlich könnten sich bei verdoppelten Preisen viele Leute Ferienreisen mit Flug nicht mehr leisten. Denkbar wären dann Preissenkungen bei nicht mehr ausgelasteten Hotels, die auf Flugreisende angewiesen sind, um Kombiangebote genügend attraktiv zu halten. Auch die Flughafengebühren dürften bei weniger Verkehr sinken.
Die zweite Frage stellt sich auf der Angebotsseite: Sind doppelte bzw. massiv höhere Preise durchsetzbar? Angesichts der bereits bestehenden und absehbar stark wachsenden Überkapazitäten im internationalen Flugreisegeschäft bezweifle ich stark, dass unter den Anbietern eine Art konkludentes Verhalten über die Preisgestaltung erzielt werden kann. Gerade haben wir als Muster einen gescheiterten Versuch der Ölpreisstützung erlebt. Viel wahrscheinlicher ist ein ruinöser Wettbewerb mit zunehmender Beanspruchung von Staatsgeldern für die „nationalen Fluggesellschaften“. Wie sehr die weltweiten Strukturen der Branche politisiert sind, zeigt das endlose Theater um die Rettung der maroden Alitalia. Trotz Subventionsverbot in der EU wurde die Alitalia seit Jahren mit inzwischen rund 10 Mrd. Euro Staatshilfe über Wasser gehalten. Und zu guter letzt wird Alitalia nun vom Staat übernommen, um die Arbeitsplätze zu retten und eine nationale Fluglinie um jeden Preis auf Kosten eines bereits massiv überschuldeten Staates zu erhalten.
Fliegen wie früher – zu höheren Preisen und mit viel mehr Platz – bedeutete allerdings eine massive Aufwertung der Reisequalität. In einem heutigen 11-stündigen Swiss-Langstreckenflug, zum Beispiel nach oder von Tokio, sollte man, in der Economy-Klasse eingeklemmt, sehr gut aufpassen, dass einem nichts zu Boden fällt. Es ist in den engen Sitzreihen beinahe unmöglich, das Ding wieder aufzuheben.
Ob dieser klaustrophobisch gewordenen Fliegerei erinnert sich der ältere Flugreisende an frühere paradiesische Zustände. In den 1970er-Jahren untersuchte ich als Mitarbeiter von Swissair die Streckenwirtschaftlichkeit von Europaflügen. Die damaligen Tarife (eine Mischung zwischen IATA-Kartell-Tarifen und Absegnung durch das geradezu Swissair-hörige Eidg. Luftamt) waren so hoch, dass eine DC9 mit 110 Sitzen für einen Flug nach Salzburg nur zu einem Viertel ausgelastet sein musste, um die variablen Kosten zu decken. Auf meinen regelmässigen Geschäftsflügen nach Salzburg zu Beginn der 1980er-Jahre war der Flieger bei weitem nie voll, und man konnte sich seinen Sitzplatz praktisch jedes Mal aussuchen. Aber dieser Kurzstreckenflug kostete ab Zürich rund 700 Franken – damalige Franken, versteht sich.
Die Massen-Billigfliegerei hat inzwischen die Erwartungen des Publikums so konditioniert, dass eine Rückkehr zu früheren Flugtarifen als unsozial und inakzeptabel verurteilt würde. Dabei könnte man dann auf eine CO2-Besteuerung verzichten. Allerdings ist eine Verteuerung von Flugreisen mit dem Argument des Klimaschutzes im breiten Publikum wohl am ehesten durchsetzbar.