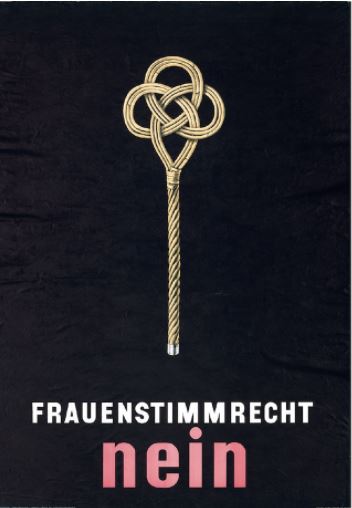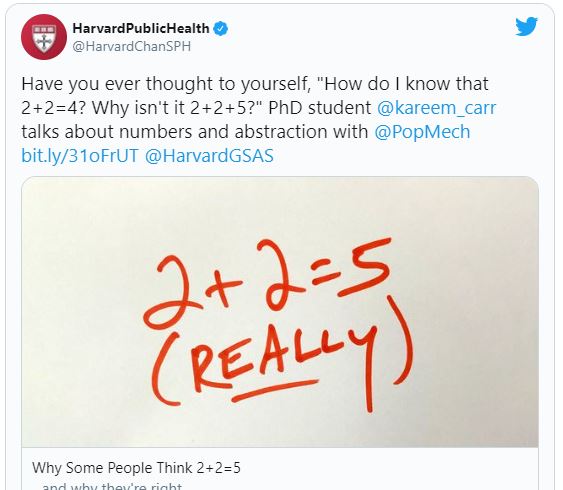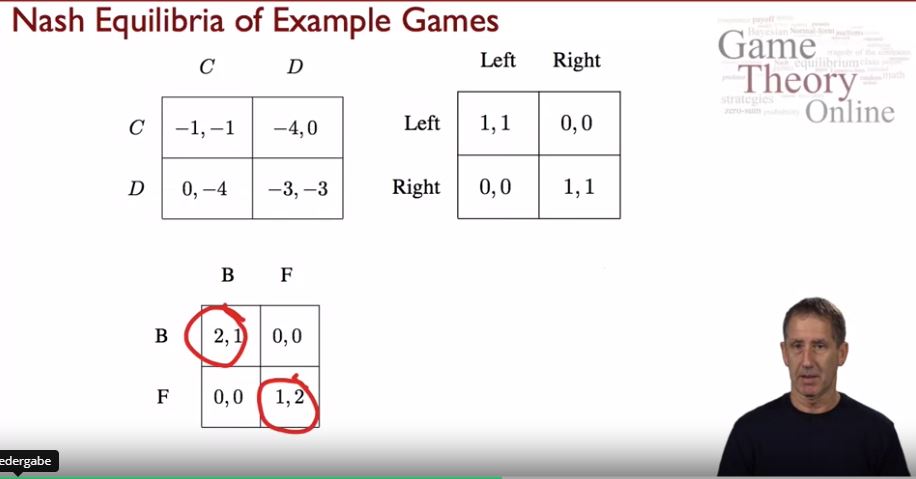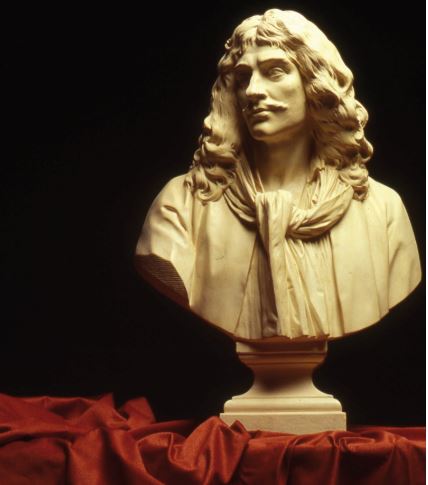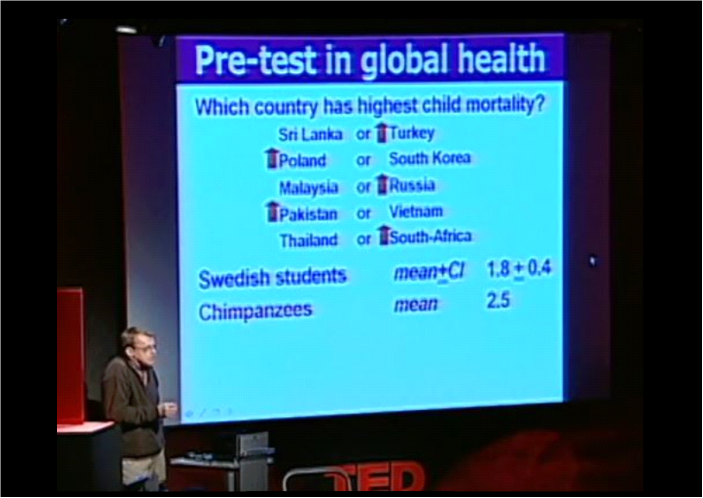So wie in den USA, läuft es auch bei uns
Am 29. Dezember 2022 erschien in der NZZ mein Artikel mit dem Titel *Klimapolitik und der neue Moraladel“. Dort kommentierte ich Ergebnisse der Referenden über das Energiegesetz (Mai 2017) und über das CO2-Gesetz (Juni 2021). Akademisch Gebildete hatten den von links-grüner Ideologie getränkten „Energiewende-Gesetzen“ in beiden Volksabstimmungen mit dem weitaus höchsten Ja-Anteil aller Bildungskategorien zugestimmt.
Zu dieser politisch-ideologischen Verschiebung der Eliten in den Sektoren der „knowledge economy“ nach links bieten die USA harte Daten zu Parteiverschiebungen nach sozio-ökonomischen Kriterien. In der Demokratischen Partei dominieren heute ganz andere Bevölkerungsgruppen als früher. Das hat auch massive Auswirkungen auf die finanzielle Unterstützung der Parteien. Ich zitiere aus einem Artikel auf der Plattform „The Liberal Patriot“ (Hervorhebungen durch Fettschrift von mir):
Two decades ago, sociologists Jeff Manza and Clem Brooks observed that “professionals have moved from being the most Republican class in the 1950s, to the second most Democratic class by the late 1980s and the most Democratic class in 1996.” This consolidation has only grown even more pronounced in the intervening years. As professionals have increasingly clustered in the Democratic Party, moreover, they’ve grown increasingly progressive, particularly on “cultural” issues surrounding sexuality, race, gender, environmentalism—and especially when compared with blue-collar workers.
Federal Election Commission campaign contribution data provides stark insights into just how strongly knowledge economy professionals have aligned themselves with the Democratic Party in recent cycles. In 2016, roughly nine out of ten political donations from those who work as activists or in the arts, academia, and journalism were given to Democrats. Similarly, Democrats received around 80 percent of donations from workers involved in research, entertainment, non-profits, and science. They also received more than two-thirds of donations from those in information technology, law, engineering, public relations, or civil service jobs. Among industries that skewed Democratic, the party’s highest total contributions came from lawyers and law firms, environmental political action committees, non-profits, the education sector, the entertainment sector, consulting, and publishing.
Similar patterns held in 2020: the occupations and employers with the largest number of workers who donated to the Biden-Harris campaign included teachers, educators and professors, lawyers, medical and psychiatric professionals, people who work in advertising, communications and entertainment, consultants, human resources professionals and administrators, architects and designers, IT specialists and engineers. Industries that provided the highest total contributions to the Democrats included securities and investment, education, lawyers and law firms, health professionals, non-profits, electronics companies, business services, entertainment, and civil service. Geographically speaking, Democratic votes in 2020 were tightly clustered in major cities and college towns where knowledge economy professionals live and work—and outside those zones, it was largely a sea of red.
The alignment of knowledge economy professionals with the Democratic Party has also shifted the socioeconomic composition of the Democratic base. To give some perspective of how much has changed: in 1993 the richest 20 percent of congressional districts were represented by Republicans over Democrats at a ratio of less than two to one. Today, they tilt Democratic by nearly five to one.
Diese ideologisch-politische Verschiebung der zahlenmässig wachsenden akademischen Elite nach links sieht man in der Schweiz auch in der Leichtigkeit, mit welcher linke Gruppierungen heutzutage Finanzen und Unterschriften für Volksinitiativen und Referenden zusammenbringen.